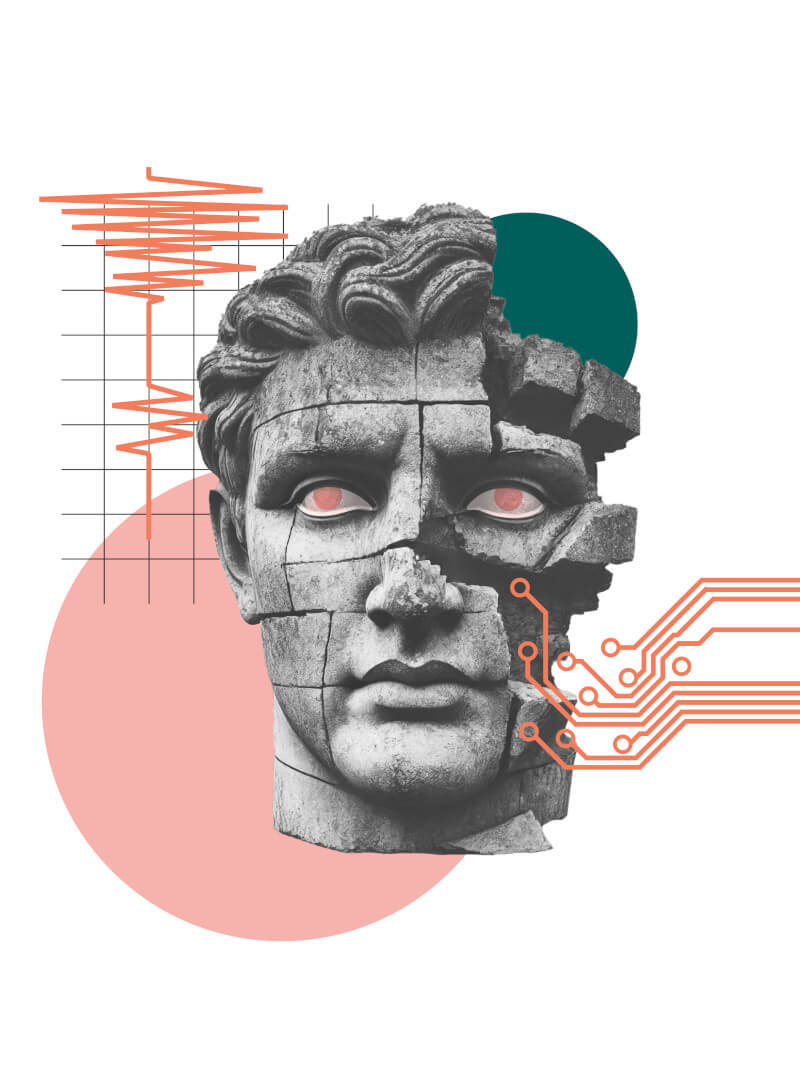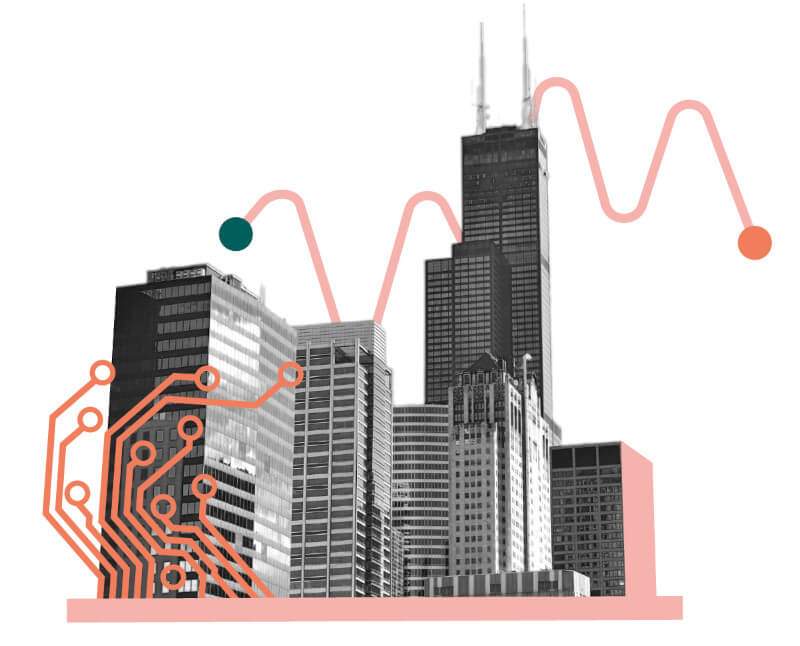Wenn nach einem Sturz auf der Skipiste oder im Garten der Arm mächtig wehtut, ergeben die Untersuchungen in der Klinik: Der Knochen ist entweder gebrochen oder nicht, vielleicht einfach, vielleicht komplizierter. Und wie er behandelt werden muss, ist dann sehr klar. Bei einer seelischen Erkrankung ist die Lage oft erheblich komplizierter, denn Diagnosen werden dort vor allem auf Basis der eigenen, subjektiven Empfindungen und Angaben gestellt. Aber ist das, was ich habe, eine Depression? Oder eine Verstimmung? Vielleicht verbirgt sich dahinter auch Erschöpfung? Und wenn der Therapeut oder die Therapeutin eine Diagnose stellen konnte, bleiben auch in Sachen Behandlung in der Regel mehr Fragen als die nach Schrauben und Gips: Welche Therapie passt am besten? Werde ich gut darauf ansprechen? Können Medikamente helfen? Und wovon hängt das alles eigentlich ab? Genau solchen Fragen will sich die Forschung im Bereich psychischer Erkrankungen mithilfe von KI nähern. Und so viel steht schon fest: Die Ergebnisse haben zwar das Potenzial, vieles zu vereinfachen. Aber der Weg dahin ist steinig.
DIE DIAGNOSE WIRD HAUPTSÄCHLICH ANHAND VON SYMPTOMEN GESTELLT.
Professor Emanuel Schwarz, Leiter des Hector Instituts für Künstliche Intelligenz in der Psychiatrie und der Arbeitsgruppe Translationale Bioinformatik am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim (ZI), sagt: „Die KI-Forschung hat sich am Anfang stark darauf fokussiert, Patientengruppen von gesunden Probandinnen und Probanden zu unterscheiden. Über die Jahre hat man aber verstanden, dass das nicht der klinisch relevante Vergleich ist. Die eigentlichen Herausforderungen liegen in der Differenzialdiagnose, Therapieauswahl und Vorhersage von klinischen Verläufen." Beim Anlernen der KI braucht es statt gesunder Probanden als Vergleichsgruppe eher andere relevante Gruppen oder Längsschnittdaten – zum Beispiel bei der Frage, ob Patientinnen und Patienten auf eine Medikation bei Schizophrenie ansprechen werden. „Man braucht harmonisierte, über einen längeren Zeitraum hinweg gesammelte Daten, um klinische Verläufe zu verstehen und vorhersagen zu können. Und da setzt das Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG) an: mit der Entwicklung harmonisierter Vorgehen, langfristig und über unterschiedliche diagnostische Kategorien hinweg."

Akribische Detailarbeit ist gefragt
Bei der Forschung ist akribische Detailarbeit gefragt, erklärt Schwarz: „Das Besondere beim Thema psychische Gesundheit ist, dass die Diagnose hauptsächlich anhand von Symptomen gestellt wird und Patientinnen sowie Patienten typischerweise nur sehr schwach ausgeprägte biologische Veränderungen zeigen. Solche biologischen Merkmale können deshalb für klinische Zwecke kaum genutzt werden." Hier greift die künstliche Intelligenz: Mithilfe der Technologie will man versuchen, kleinste Veränderungen und Ausprägungen zusammenzubringen und zu Modellen zu kommen, die aussagekräftiger sind als die Betrachtung einzelner Veränderungen.
DIE DATEN, DIE VERWENDET WERDEN, STAMMEN AUS GROSSEN GEMEINSCHAFTSPROJEKTEN.
Am ZI in Mannheim wird daher intensiv an der Nutzung von Omics-Daten und künstlicher Intelligenz geforscht. Das Team sucht in großen Datenmengen der Gene, Eiweiße, Stoffwechselprodukte und chemischen Veränderungen in Zellen nach Mustern, die helfen können, Auswirkungen auf psychische Erkrankungen zu erkennen und deren Entstehung vorherzusagen. Ziel ist es dabei auch, Biomarker zu finden, die Aussagen über diese Erkrankungen zulassen. „Die Forschung erstreckt sich bei psychischen Erkrankungen auf extrem viele Teilbereiche und Datentypen", fasst Professor Emanuel Schwarz das Feld zusammen. Durch die Kombination dieser Daten wollen Forschende die komplexen Wechselwirkungen verschiedener Faktoren präziser untersuchen und bewerten. Schwarz erklärt: „Man hofft, durch dieses Zusammenführen von Daten zum Beispiel der Genetik oder Aufnahmen des Gehirns noch bessere Vorhersagen treffen zu können und dabei einen Grad zu erreichen, der klinisch nutzbar ist." Klar ist aber auch: Die KI wird keine absoluten Sicherheiten liefern können. „Es geht um Wahrscheinlichkeiten", sagt Schwarz.
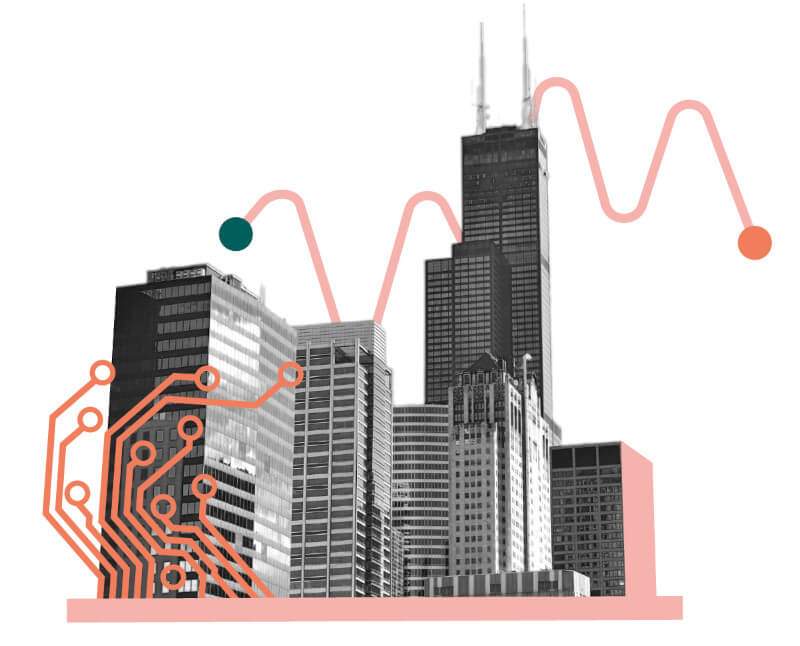
Riesige Datenmengen als Grundlage
Die Daten, die verwendet werden, stammen aus großen Gemeinschaftsprojekten. Nur so wird das Volumen erreicht, das zum Anlernen der KI nötig ist. Die Integration und Harmonisierung dieser großen und zum Teil heterogenen Datenmengen sowie die genaue Gruppierung von Patientenkohorten ist noch in Arbeit. Zudem erfordert die Entwicklung und Validierung voraussagender Modelle nicht nur umfangreiche Stichprobengrößen, sondern auch hochmoderne IT-Infrastrukturen. Am ZI wird deshalb derzeit eine IT-Infrastruktur aufgebaut, die Hardwareressourcen für die Datenanalyse flexibel bereitstellen soll. Für Erkrankungen, die an bestimmten Symptomen leicht zu erkennen sind, werden früher Erkenntnisse zu Biomarkern erwartet als für solche, bei denen das Krankheitsbild komplexer ist. Kerstin Ritter ist Juniorprofessorin für Computational Neuroscience an der Charité – Universitätsmedizin Berlin, ihr Podcast trägt den Namen „Dr. med. KI". Sie beschreibt die Gründe: „Bei manchen psychischen Erkrankungen gibt es große Unterschiede: Ist jemand depressiv oder ist er oder sie vor allen Dingen traurig oder grübelt viel? Will man das mit KI anschauen, muss man im ersten Schritt fragen, was man eigentlich sucht und vorhersagen will. Dafür braucht man klare und genaue Bezeichnungen. Hier liegen wichtige Fragestellungen nach dem Wesen und Schweregrad von Diagnosen und wie man das misst." Vor dem Füttern der KI mit Daten steht also die Suche nach der Datengrundlage selbst.
Jugendliche Gehirne im Visier
Ritter forscht selbst an einem Beispiel für die erfolgreiche Anwendung von Machine Learning in der Psychiatrie: Anhand von Aufnahmen bestimmter Gehirnstrukturen soll der Umgang von Jugendlichen mit Alkohol untersucht werden. Der entwickelte Algorithmus ist in der Lage, Alkoholmissbrauch im Jugendalter mit einer Genauigkeit von 73 bis 78 Prozent vorherzusagen. Besonders vorhersagende Gehirnregionen sind dabei die weiße Substanz sowie bestimmte Nervenzell-Areale im Gehirn.

Professorin Ulrike Lüken untersucht als Sprecherin der DFG Forschungsgruppe 5187 PREACT („Towards precision psychotherapy for non-respondent patients: from signatures to predictions to clinical utility") am DZPG-Standort Berlin-Potsdam die Vorhersage des Therapieerfolgs bei internalisierenden Störungen anhand multimodaler Daten – einer Kombination aus Neuro-Bildgebung, klinischen Daten, psychologischen und Smartphone-Daten. Eine Gruppe von 585 Patientinnen und Patienten mit verschiedenen Angst- und Zwangsstörungen, Depressionen oder einer posttraumatischen Belastungsstörung wird über längere Zeit genau untersucht. Die Forschenden wollen herausfinden, welche biologischen und Verhaltensmerkmale zeigen, ob eine Behandlung erfolgreich ist. Kerstin Ritter erklärt das Ziel: „Es gibt immer wieder Betroffene, die nicht von Therapien profitieren. Es wäre sehr hilfreich, wenn wir sie identifizieren und ihnen Alternativen anbieten könnten."
DER ENTWICKELTE ALGORITHMUS IST IN DER LAGE, ALKOHOLMISSBRAUCH IM JUGENDALTER MIT EINER GENAUIGKEIT VON 73 BIS 78 PROZENT VORHERZUSAGEN.
Mit GPT zu prädiktiven Mustern
Aber nicht nur bei der komplizierten Analyse von Kombinationen aus zum Beispiel Bildgebungs- und Omics-Daten mit eigens entwickelten Tools sieht Professor Schwarz Potenzial für weitere Forschungen, sondern auch bei der Auswertung reiner Texte: „Durch Language-Modelle wie GPT können wir jetzt aus frei geschriebenem Text prädiktive Muster herauslesen – zum Beispiel aus klinischen Texten, die von Ärztinnen und Ärzten oder von klinischem Personal geschrieben werden. So könnten aus Entlassungsberichten oder Arztbriefen vorhersagende Muster abgeleitet werden, die klinisch nützlich sind. Darin steckt großes Potenzial."
Potenzial sieht auch Kerstin Ritter in der KI-Forschung des DZPG: „Langfristig erwarte ich auf jeden Fall eine bessere Gesundheitsversorgung. Wenn man Personengruppen besser charakterisiert und gute Vorhersagen treffen kann, welche Therapien bei wem erfolgreicher sind, wird das Vorteile in der Prävention, Behandlung und Diagnostik bringen." Professor Schwarz ergänzt: „Insofern ist die künstliche Intelligenz ein Werkzeug, mit dem wir versuchen, etwas zu erreichen, was vorher nicht möglich war."