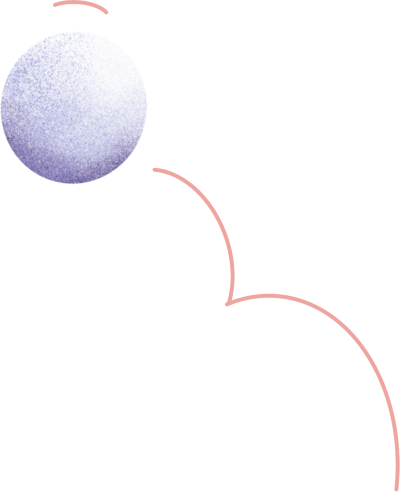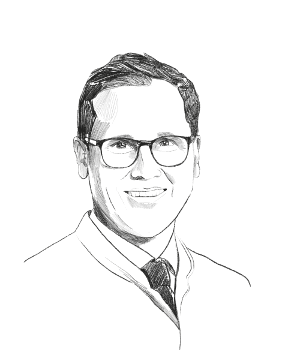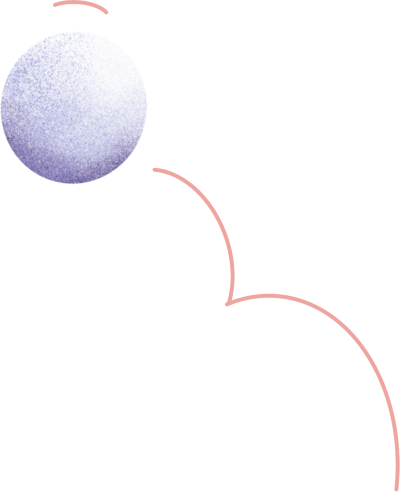
Wenn Sie auf die Organe des menschlichen Körpers schauen: Inwieweit arbeiten diese autark oder wie sehr „sprechen“ sie miteinander – und wie kommt es zu dieser Interaktion?
In der Klinik sehen wir tagtäglich, dass letztendlich kein Organ unabhängig ist. Sie produzieren quasi ein systemisches Milieu, dem alle anderen Organe dann auch ausgesetzt sind.
Ein Beispiel dafür, dass alle Organe miteinander verbunden sind, ist auch das Zentrale Nervensystem (ZNS): Es gibt kein Organ, das nicht über Nerven versorgt wird. Eine weitere Verbindung sind Botenstoffe wie Zytokine, die gesendet und erkannt werden. Auch das Immunsystem, dessen Zellen und Botenstoffe von Organ zu Organ schwimmen und sich dort betätigen, kann man als Kommunikationsweg sehen.
Neben dem ZNS ist unter anderem die Leber zu nennen, die Fette abgibt, die sogenannten VLDLs, welche in andere Organe gehen und dort zur Energieversorgung genutzt werden. Die Leber bildet auch Glukose – den Zucker, den alle Organe zur Energieerzeugung nutzen. Wenn solche Stoffe bei den anderen Organen ankommen, teilen sie ihnen dadurch auch mit, wie es um den Energiestatus insgesamt steht. So kooperieren also die Organe – sie sprechen miteinander. Das bedeutet: Wenn wir sie einzeln betrachten, müssen wir uns bewusst sein, dass man wahrscheinlich einen Großteil dessen, was die Organe steuert, nicht in Betracht zieht. Wenn man wirklich verstehen will, wie Physiologie funktioniert und sich Pathophysiologie – also krankhafte Veränderungen im Körper – bildet, muss man das Organsystem in Gänze betrachten.
Wie gehen Sie als Forschende mit diesen Erkenntnissen um und was bedeuten sie für die Behandlung von Patientinnen und Patienten?
Als Forschende studieren wir diese Kommunikationswege natürlich in Teilsystemen, aber auch in Modellen wie beispielsweise an Tieren. Da kann man das System herausfordern, indem man etwa eine bestimmte Diät gibt und schaut, wie sich die Arterien, die Leber oder auch das ZNS verändern. Und solche Einflussfaktoren wirken oft nicht nur auf ein Organ, sondern direkt oder indirekt auf mehrere.
Bei der Behandlung von Erkrankungen schauen wir mittlerweile auch sehr genau auf die pleiotrope Wirkung von Medikamenten: Wirken sie nur da, wo wir das ursprünglich angenommen haben, oder gibt es Folgen für andere Organe? Diabetes ist ein gutes Beispiel für Organ Crosstalk: Im Kern ist er eine Erkrankung der Betazellen in der Bauchspeicheldrüse. Trotzdem wissen wir, dass fast jedes andere Organ mitbetroffen sein kann, etwa die Gefäße, das Herz, die Leber und die Niere. Es gibt Medikamente, die das abbilden, wie beispielsweise SGLT-2-Hemmer und GLP-1-Rezeptoragonisten, die positive Wirkungen auf Herz und Niere haben. Über die Entwicklung solcher Medikamente können unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu beitragen, dass wir viele Erkrankungen besser behandeln können. Was ich noch anmerken möchte: Wir betrachten das ZNS häufig so, dass es die Peripherie steuert. Aber die Peripherie beeinflusst genauso das ZNS. Wir wissen, dass zum Beispiel die Insulinresistenz, die beim Typ-2-Diabetes vorliegt, zu neurodegenerativen Erkrankungen führen kann.
INTERDISZIPLINÄRES ARBEITEN IST UNERLÄSSLICH, UM DIE KOMPLEXITÄT VON ORGAN CROSSTALK ZU BEWÄLTIGEN.
Ja, das sehe ich auch so. Interdisziplinäres Arbeiten ist in jedem Fall unerlässlich, um die Komplexität von Organ Crosstalk zu bewältigen. Wir arbeiten schon stark interdisziplinär, aber das darf noch viel mehr werden. Die DZG sind ein gutes Beispiel, wie Kooperation gelingen kann: Wir arbeiten innerhalb der Zentren mehr und mehr zusammen und schauen beispielsweise gerade mit dem DZNE und dem DZHK, ob wir unsere Kohorten gemeinsam nutzen können. Für uns wäre das interessant, um die Folgeerkrankungen des Diabetes besser zu verstehen.
Wie viel Initiative geht von den Forschenden selbst aus?
Viel. Die Initiative geht meistens von Individuen aus, denen eine Wissenslücke auffällt oder die Modelle aus anderen Disziplinen brauchen, um etwas besser zu verstehen.
Ein wichtiges Ziel der DZG ist die Translation in die Praxis. Wenn ich jetzt als Patientin oder Patient eine Diabetes-Diagnose bekomme, wie sehr erlebe ich dann, dass die Kommunikation der Organe bei dieser Erkrankung berücksichtigt wird?
Wir haben gerade in den vergangenen zehn Jahren sehr viel über die Erkrankung Diabetes und ihre Auswirkungen gelernt und das kommt zunehmend in der Praxis an. Ein schönes Beispiel ist eine neue Therapieform, bei der man zwei Hormone des Magen-Darm-Trakts miteinander kombiniert: GIP und GLP-1. Die Idee und das Know-how dazu stammen von den Münchner Partnern des DZD, dem Helmholtz Zentrum München. Das Medikament ist jetzt für die Diabetesbehandlung zugelassen und sehr vielversprechend.
Was müssen aber die einzelne Medizinerin, der einzelne Mediziner auch für sich persönlich begreifen, um es im Gespräch mit den Patientinnen und Patienten abbilden zu können?
Ich denke, die einzelnen Disziplinen haben schon sehr holistische Ansätze. Bei einem gut ausgebildeten Internisten etwa bekommt man wirklich eine gute Beratung und Behandlung für viele Erkrankungen.
Auch wenn wir einzelne Fachgebiete in der Medizin haben, versuchen wir natürlich, andere Punkte mit einzubeziehen. Und wenn es mal nicht geht oder wirklich zu komplex wird, gibt es die Kolleginnen und Kollegen, die in der Klinik ja nur wenige Türen weiter zu finden sind. Für das DZD kann ich sagen, dass wir Kooperationsprojekte haben und Ausschreibungen für Kollaborationen innerhalb der DZG. Auch das funktioniert schon sehr gut.
Wenn Sie beide auf Ihre Karriere schauen: Wo gab es vielleicht Punkte, an denen Sie spannende Überschneidungen entdeckt haben?
Ich finde es immer wichtig, zu Konferenzen zu gehen – möglichst auch zu solchen, die nicht nur das eigene Gebiet betreffen. Daran denke ich jetzt, weil ich mal auf einer Konferenz für bildgebende Verfahren war und selbst einen Vortrag gehalten habe. In der Session nach mir hat jemand davon berichtet, wie er in Arterien Kristalle entdeckt hat. Cholesterin-Kristalle – von denen ich nicht mal wusste, dass es sie gibt! Ich habe den Kollegen gebeten, mir alle Unterlagen zu schicken, und nach einer Woche wussten wir, dass es auch in Arterien, im Gehirn und an vielen weiteren Stellen im Körper Cholesterin-Kristalle gibt und dass sie an Entzündungsprozessen mitwirken. Das hat sich dann so ausgeweitet, dass ein Molekül gefunden wurde, das diese Kristalle auflösen kann – es wird derzeit in einer großen klinischen Studie untersucht.
Ich kann als Beispiel etwas anführen, mit dem ich quasi meine Karriere begonnen habe: Im Herz werden Hormone, sogenannte natriuretische Peptide ausgeschüttet – ANP und BNP. Man nutzt sie zur Diagnostik der Herzinsuffizienz. Wir wollten wissen, ob sie auch Wirkungen auf den Stoffwechsel haben. In der Tat konnten wir herausfinden, dass ANP beispielsweise das Fettgewebe so beeinflusst, dass mehr Fettsäuren abgegeben werden. Das Herz versorgt damit also seinen eigenen Energiehaushalt. Wir konnten auch sehen, dass es den Muskel dazu bewegt, die mitochondriale Aktivität zu erhöhen, also in einen Sportmodus schaltet. Man kann also feststellen, dass das Herz ein Hormon ausschüttet, das den Stoffwechsel in anderen Organen so beeinflusst, dass sowohl der Körper darauf eingestellt wird, dass mehr Aktivität erfolgt, als auch, dass sich das Herz selbst darüber mit Energie versorgt. Diese Erkenntnis war sehr überraschend und sie begeistert mich eigentlich bis heute. Wir suchen nach Wegen, ob man das Prinzip therapeutisch nutzbar machen kann über die Rezeptoren, die es dafür gibt. Das ist ein sehr spannendes Feld und genau damit fängt es oft an: Wir stellen uns Fragen dazu, wie das eine mit dem anderen zusammenhängen könnte. Die DZG bieten in der aktuellen Form den idealen Projektionsort, an dem dann die entsprechende Forschung umgesetzt werden kann.